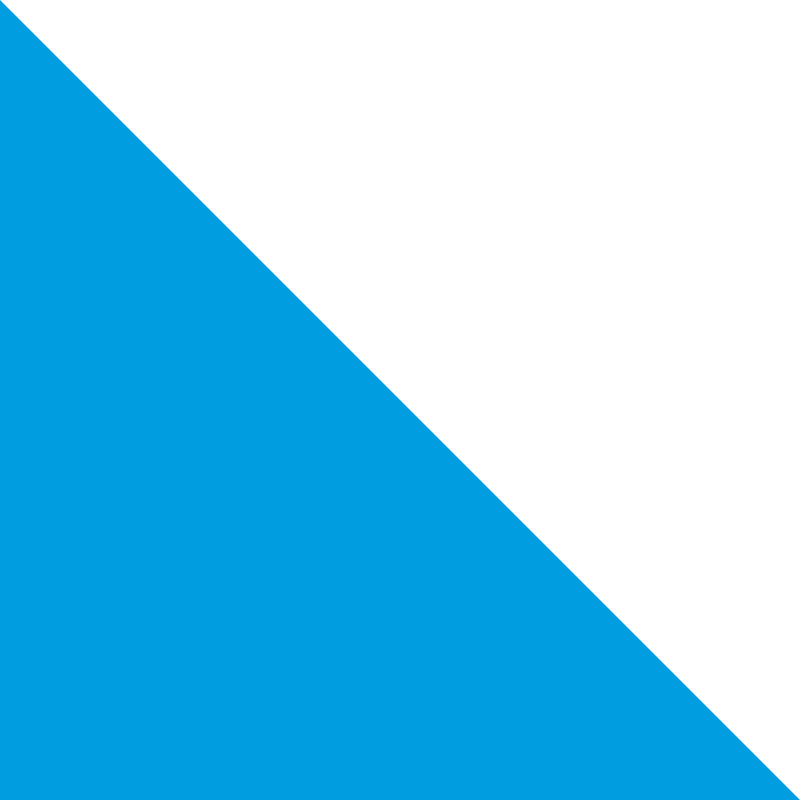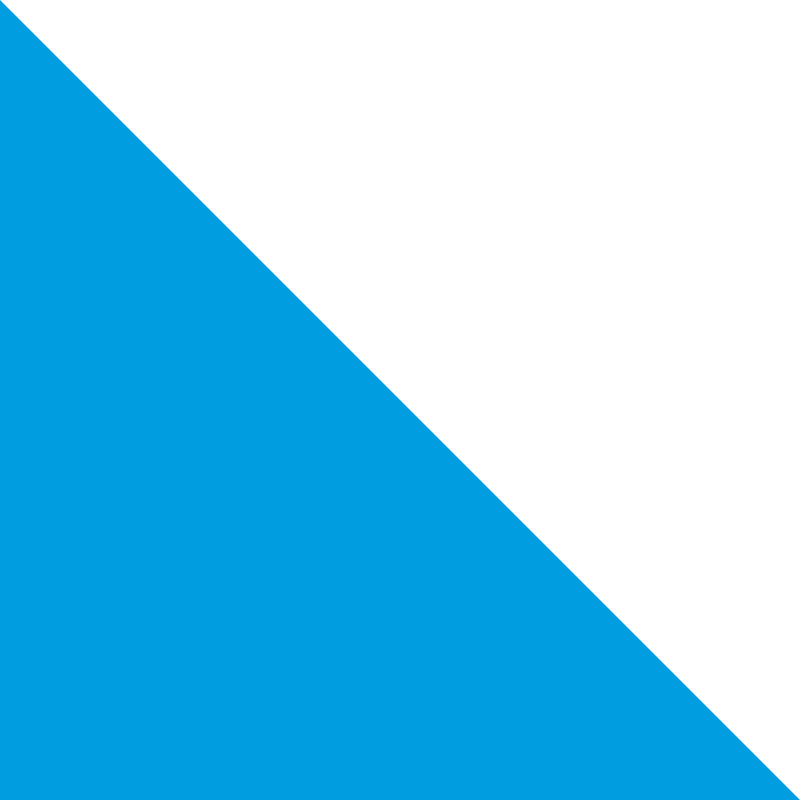Beschreibung
Soweit wir das beobachten können, nutzt die grosse Mehrheit der Lernenden auf SekII-Stufe KI, insbesondere ChatGPT, selbständig, währenddem KI nicht von vielen LP im Unterricht eingesetzt wird.
Einige LP sagen, sie hätten mit dem Einsatz von KI sogar Mehraufwand, z.B. beim (Vor-)Korrigieren von Texten der Lernenden durch KI, weil sie dann doch alle von KI produzierten Kommentare überprüfen müssten, insbesondere bezüglich ‘Halluzinationen’. Ausserdem bezweifeln viele, ob sich der beträchtliche Initialaufwand lohne, weil es gewisse KI-Tools vielleicht nach kurzer Zeit gar nicht mehr gebe. Unser Projekt hat das Potential, eben solchen Initialaufwand durch die Erfahrungen, die wir weitergeben, beträchtlich zu senken. Zudem steht beim Sprachtraining die genaue Faktenlage nicht immer im Vordergrund. Die Tools produzieren jedoch korrekte und vielfältige Sprache und können Regeln erklären oder Fehler verbessern (mit Erklärung), was die LP potenziell entlastet.
Was Hattie in seinen Studien gezeigt hat (und in seiner kürzlich erschienenen Publikation «The Sequel» erneut unterstreicht), kann mit Hilfe von KI-Tools nun effektiv umgesetzt werden: viel Feedback, möglichst unmittelbar und mit Hinweisen «where to go next». KI kann beim Einüben von grammatikalischen Strukturen, Hörverständnis, Sprechen, Schreiben, sowie der Vertiefung in (literarische) Texte genau dies tun – auf individueller Basis – und dadurch Vertrauen aufbauen in die eigenen Sprach- und Interpretationsfähigkeiten. Dies antizipiert und erleichtert eine spätere Interaktion mit einem menschlichen Gegenüber, z.B. bei der Diskussion eines Ausschnitts aus einem literarischen Text im Klassen-
Plenum oder gar an der mündlichen Maturaprüfung. Ausserdem können die Lernenden lange Zeit selbstständig arbeiten und jeweils entscheiden, wieviel mehr sie noch üben müssen oder wollen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wir führen die Lernenden auf möglichst allen 4 bzw. 6 Jahrgansstufen des Gymnasiums ein in den stufengerechten Umgang mit KI-Tools und regen an, das Potential dieser Instrumente für ihr Lernen auszuloten. Nach einer Einführungsphase gibt es genug Zeit, um während der Lektionen, begleitet, Erfahrungen mit KI zu machen, und dabei schnell viel zu lernen und auch viel Spass zu haben. Nebst Sprechen, Lesen und Hören wird es auch einen Fokus auf Schreibprozesse geben. Unter Einbezug des Konzepts der Eigenverantwortung im Lernprozess und mit klaren Regeln zur Deklaration der Herkunft und Produktion von Inhalten wird auch projektartiges Arbeiten zu zweit oder in kleinen Gruppen auf der Sek II-Stufe möglich sein. Wir dokumentieren dann, was gut funktioniert hat, damit andere Lehrpersonen deutlich weniger Aufwand bei der Vor- und Nachbereitung haben, wenn sie Ähnliches versuchen wollen.
Didaktisch-methodisches Konzept
Einführung in die Handhabung der zu benutzenden KI-Tools. Abstecken des Ranges von möglichen Lernzielen in der aktuellen Phase des Unterrichts. Bestimmen, wie diese Ziele überprüft werden, und wann sie als erreicht gelten und wieviel Zeit insgesamt für eine Phase zur Verfügung steht.
Dann in Eigenverantwortung individuell, zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten. Support durch die Lehrperson
bezüglich Sprachlichem, Inhaltlichem, Technischem, bei Kleingruppen auch bezüglich Zusammenarbeit – wo gefragt oder notwendig.